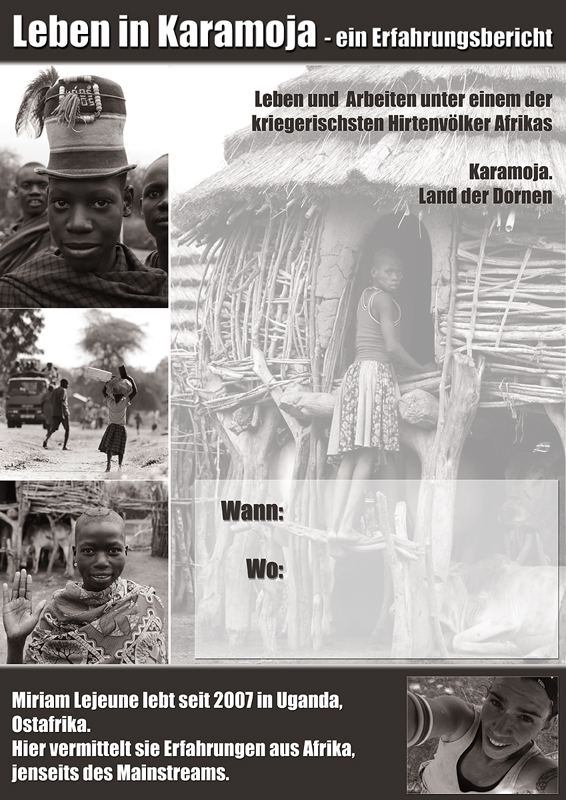Letzte Woche stöberten Miriam und ich in einigen Läden im "Afrikaviertel" und dort entdeckte ich für mich total unbekannte Instrumente. Inzwischen hab ich mich schlau gemacht und hier nun ...
...ein Einblick in das Kunsthandwerk und den Instrumentenbau in Uganda
Man kann Rhythmus erzeugen, indem man in die Hände klatscht, oder man erzeugt Töne, indem man auf ihnen bläst.
Es gibt eine Vielzahl von leicht und hart geblasenen Blasinstrumenten. Dabei wird Luft in ein Mundstück geblasen, wodurch eine Schwingung erzeugt wird, die wiederum einen Ton erzeugt, ohne dass dabei die Lippen verwendet werden. Diese Methode findet sich auch im Zusammenhang mit dem Mundstück der Trompete. Solche Instrumente sind aus Ton, Holz oder Tierhorn gefertigt, heute werden sie natürlich auch aus Metall oder Kunststoff hergestellt. Einige dieser Instrumente werden als Kinderspielzeug oder auch in Ritualen verwendet.
Die verschiedenen Stämme in Uganda spielen ebenfalls auf Saiteninstrumenten, auf welchen sowohl improvisiert wird als auch die Begleitung von Texten gespielt. Diese Saiten können durch das Spinnen oder Drehen von Sisal, Hautstreifen oder Fasergeweben erzeugt werden. Instrumente, an welchen solche Saiten auf verschiedene Weise an unterschiedlichen Rahmenformen befestigt sind, werden gepickt, gezupft, geschrammelt, geschlagen oder gestreichelt. Manche dieser Instrumente sind nur temporäre Instrumente, dabei manche nur so kurz, dass wir sie hier gar nicht auflisten, wie z.B. dieses hier: eine Saite wird an einem Ende gehalten, indem mit den Zähnen darauf gebissen und das andere Ende gestreckt wird, während die rechte Hand die Saite zupft oder sie mit den Fingern streichelt. Verschiedene Noten können gespielt werden, indem die Saite dementsprechend gelockert und angespannt wird.

-Adungu, Adeudeu
Bogenharfe - Saiteninstrument
Die achtsaitige Ennanga der Buganda und die sechssaitige Adeudeu (Bogenharfe) der Iteso haben eine ähnliche Form wie die acht- oder mehrsaitige Adungu aus der westlichen Nilregion.
Die Adungu ist eine neunsaitige (gebogene) Harfe der Alur-Stämme aus dem nordwestlichen Uganda. Sie ist der Tumi-Harfe der benachbarten Kebu-Stämme sehr ähnlich, und sie wird auch von den Lugbara und Ondrosi in dieser nordwestlichen Region rund um den Nil verwendet. Die Harfe wird verwendet, um epische und lyrische Lieder zu begleiten, und sie wird auch als Soloinstrument oder in Ensembles eingesetzt. Spieler der Bogenharfe besassen bereits immer einen hohen sozialen Status, und sie gehören auch zum königlichen Gefolge. Heute wird die Bogenharfe nun auch in Kirchen gespielt.
Die Adungu besteht aus einem bogenförmigen Hals, einem Resonanzkörper aus Holz, in welchem der Hals befestigt ist, sowie aus einer Reihe parallel geführter Saiten unterschiedlicher Länge, die gezupft werden. Die Saiten sind an einem Ende am Resonanzkörper befestigt und laufen in einem schiefen Winkel zum Hals hin aus, wo sie befestigt sind und mithilfe von Wirbeln gestimmt werden.
Die erste, zweite und dritte Saite sind in Oktaven mit der sechsten, siebten bzw. achten gestimmt. In der traditionellen Musik ist das Instrument pentatonisch (fünf Töne) gestimmt, es kann im modernen Stil aber auch in einem diatonischen Mass gestimmt werden.

- Endongo - Entongoli
Leier - Harfenlaute - Kora - Streichinstrument
Die Baganda bezeichnen sie manchmal als Endongo, wenn das Instrument zur Führung eines Hochzeitstanzes gespielt wird, (Embaga). Im östlichen Uganda wird ein ähnliches Instrument als Litungu bezeichnet. Die Bagishu spielten sie für den Schultertanz und bezeichneten sie als Kamabega.
Hierbei handelt es sich um den bekanntesten Vertreter der Buganda und der Busoga Region. Im Allgemeinen ist die Harfenlaute das Instrument der Griot-Vertreter, oder Lobliedsänger, wie dies die ähnliche Kora oder Soron bei den Menschen von Guinea, der Elfenbeinküste, aus dem Senegal, Gambia und Südmali ist. Es wird entweder als Soloinstrument gespielt oder zur Begleitung von Lobliedern verwendet. Die Endongo weist sechs bis acht Saiten auf, die gezupft werden. Die Struktur des Instruments unterscheidet sich aber von der eigentlichen Harfe sehr stark. Sie besteht aus einem grossen halbkreisförmigen Resonanzkörper aus Kürbis, über den ein langer und gerader zylindrischer Hals oder Querbalken verläuft, dessen unteres Ende sich über die Basis hinaus erstreckt und dazu dient, die Saiten zu halten. Die Saiten bestehen aus Ochsensehnen, die an plattierten Lederringen befestigt sind, die entlang des Querbalkens bewegt werden können, um die Saiten zum Klingen zu bringen. Die Saiten verlaufen entlang der zwei Seiten eines grossen gekerbten Stegs in der Mitte des Klangtisches, der sie in zwei parallele Sätze unterteilt. Der Spieler hält das Instrument vor sich, so dass er die Saiten zwischen dem Steg und dem Hals mit Daumen und Zeigefinger jeder Hand zupfen kann. Die Leier besitzt einen vierseitigen Rahmen, der aus dem Klangkörper, zwei Armen und einem Querbalken besteht.
Die Endongo, die Leier der Ganda (Baganda), besitzt eine Öffnung, und die Entongoli, die Leier der Songa, besitzt zwei Stücke aus Stoff, Rinde oder Bananenblättern, die um den Rahmen herum gewickelt sind. Die Saiten sind eng um die Faser gewickelt, was danach als Stimmwirbel dient. Die Saiten sind nicht in der Ordnung ihrer Tonhöhen angeordnet. Die höchste Tonhöhe im Stimmumfang ist die dritte von links, die niedrigste ist die fünfte Saite. Die Saiten 7, 2, 4, 1 und 5 sind in Oktaven gestimmt.

- Ennanga - Nanga
Holzzither - Saiteninstrument
Dieses Instrument wurde von den Hamiten nach Uganda gebracht, und es wird sehr häufig von den Stämmen der Bakiga und Acholi gespielt. Dieses Saiteninstrument streicht die erzählerische und Geschichten erzählende Tradition der Menschen hervor. Liebeslieder, Loblieder, Epen, Trauerlieder und lustige Lieder.
Afrikanische Zither besitzen einen bootsförmigen Resonanzkasten. In altern Darstellungen sind diese oftmals in der Hand von Frauen abgebildet.
Sie ist ein Soloinstrument und besitzt acht Saiten, die über eine hölzerne Wanne laufen. Eine Zither ist ein Instrument, bei welchem die Saiten parallel zum Resonanzkörper verlaufen, der sich über die gesamte Länge der Saiten erstreckt.

- Sekitulege- Berimbeau
Musikbogen - Saiteninstrument
Der Musikbogen ist die einfachste Form eines Saiteninstruments; man glaubt, dass es sich aus dem Jagdbogen entwickelt hat, der zum Abschiessen von Pfeilen konstruiert wurde. Der Musikbogen ist der Ursprung aller Saiteninstrumente, oder zumindest der Vorfahre der Harfe, und geht auf eine sehr frühe Zeitrechnung zurück.
Diese Version ist bei den Buganda und Busoga Stämmen sowie in der Region des Westnils sehr beliebt. Sie besitzt nur eine Saite, deren Tonhöhe von der Spannung des Bogens abhängig ist. Ihr Resonanzkörper aus Kürbis.

- Endingidi - Adigirgi
Röhrenfiedel - einsaitige Fiedel - Saiteninstrument
Dieses Instrument ist in den Regionen Buganda, Busoga, Ankole, Kigezi, westlicher Nil und Acholi bekannt. Es besteht aus einer einzelnen Saite, die an einem biegsamen Stock befestigt ist und manchmal einen Resonanzkörper besitzt. Anders als andere Einsaiteninstrumente wird diese Fiedel mit einem Bogen gespielt.
Diese Geige wird auch als Endingire, Akadingidi, Endingidi, Esiriri oder Shilili in den verschiedenen Bantudialekten bezeichnet; von den nicht-Bantu-Stämmen wird es als Arigirigi, Rigirigi bezeichnet. Dieses Instrument entnimmt seinen Namen dem Blasvorgang sowie der Tonart, die dieses Instrument erzeugt. Das Instrument wird gespielt, um Wörter oder Phrasen auszudrücken, so wie ein Papagei die menschliche Stimme imitiert. Es handelt sich im Wesentlichen um ein Soloinstrument mit Gesang, das aber auch als Duett, Trio oder gemeinsam mit anderen Instrumenten gespielt wird.

- Endere
Flöte - Blasinstrument
Die Flöte ist in allen Regionen Ugandas sehr beliebt mit fünf Grifflöchern. Sie wird sowohl als Solo- als auch als Begleitinstrument eingesetzt.
Die Endere der Baganda, die Omukuri der Banyankore und der Bakiga, die Akalere der Basoga sowie die Alamaru der Iteso sind in ihrer Herstellung wie auch ihrer Verwendung ähnlich. Das Instrument wird am leicht V-förmigen geschlitzten Ende des Instrumentes geblasen, wobei es für gewöhnlich vier Fingerlöcher aufweist. In Ankole (Nkole) wird das Instrument auch manchmal in der Begleitung von Trommeln gespielt. Werden die Instrumente nicht zur Tanzbegleitung gespielt, so spielen die Menschen darauf sanfte Melodien für das grasende Vieh sowie um Liebeslieder darzubieten. In Buganda kann es als Soloinstrument verwendet werden, im Duett aber auch in kleineren Ensembles. Ein solches Ensemble besteht aus der grössten Flöte (kiwuwa), der mittleren Flöte (enkoloozi); der drittgrössten Flöte (entengezi); sowie der kleinsten Flöte (entengo). In der Region Busoga ist es ein dominantes Instrument, das in Kombination mit anderen Blas- oder Schlaginstrumenten gespielt wird. Die Iteso spielen diese Flöte meistens als Soloinstrument, oder sie begleiten sie mit einem Akogo (Fingerklavier).

- Enkwanzi
Panflöte - Blasinstrument
Die Enkwanzi oder Oburere ist eine Panflöte, die aus der Region Busoga kommt und aus Elefantengras oder Bambus gefertigt ist. Es handelt sich dabei um gestopfte Flöten, was bedeutet, dass der Knoten der Pflanze das Hohlrohr stoppt und somit die Tonhöhe des Rohrs bestimmt. Die Rohre sind vom höchsten zum niedrigsten Ton hin angeordnet und mit einer Schnur zusammengeschnürt. Die Oberkante am oberen Ende jedes Rohres ist in einem rechten Winkel geschnitten, so dass der Spieler über die Oberkante hinweg blasen kann, ähnlich wie etwa beim Blasen über eine Flasche hinweg.
Diese Panflöte besitzt zumindest fünf Rohre. Die melodischen Möglichkeiten der Panflöte und anderer Flöten waren für die Entwicklung von Flöten mit Fingerlöchern wohl massgeblich.
Instrumente, die durch eine schwingende Luftsäule Töne erzeugen, werden als Aerophone bezeichnet. Bei den Flöten richtet der Musiker einen Luftstrom über die scharfe Kante eines offenen Mundstückloches in der Seite oder Oberseite des Rohres.

- Amakondeere - Engombe - Enzambe
Horn - Holztrompete - Blasinstrument
Diese Instrumente findet man im gesamten Gebiet Ugandas, und man glaubt, dass sie ihren Ursprung bei den Buschmännern und Hamiten haben. Die Verwendung von Holztrompeten ist eng mit Ahnenkult und Initiationsriten für Erwachsene verknüpft.
Diese Instrumente werden aus verschiedenen Materialien gefertigt. Trompeten mit hohen Tonlagen werden aus Antilopenhörnern gebaut. Trompeten mit mittlerer Tonlage werden aus Baumwurzeln ausgehöhlt. Diese Instrumente besitzen ein schräg geschnittenes Mundloch, so dass das Instrument in einer Querposition gespielt wird.
Instrumente mit niedriger Tonlage werden auch aus den Stämmen des Papayabaumes geschnitzt und werden in einer geraden Position durch ein Mundloch am Ende geblasen. In einem Ensemble dieser Instrumente bringt jeder Spieler seine individuelle Tonhöhe in einem rhythmischen Muster, das innerhalb eines sehr präzischen metrischen Rahmens definiert ist, zum Klingen. Die enge Verknüpfung der einzelnen Trompeten innerhalb dieses Rahmens in einem sehr schnellen Tempo.
Instrumente, die durch eine schwingende Luftsäule Töne erzeugen, werden als Aerophone bezeichnet. Hörner sind eine Art der Blechblas- oder Lippentoninstrumente.
Die Amakondeere der Baganda, Banyoro und Batooro, die Amagwala der Basoga und die Agwara aus der westlichen Nilregion (das Volk der Lugbara und Kebu) sind lange Hörner (Ton ähnlich wie jener von Trompeten), bestehen aus ausgehöhlten Holzrahmen, die an einem Ende grösser sind und ein Loch besitzen, um hier durchzublasen. Diese Instrumente werden in der Gruppe gespielt. Sie sind mit Kuhhaut bedeckt, um ihnen eine wunderschöne und verschiedenfärbige Oberfläche zu verleihen. Im Allgemeinen sind alle diese Gruppen königliche Instrumente. In Uganda, Bunyoro und Batooro wurde sie im Königspalast für Zeremonien wie Krönungen und Hochzeiten verwendet, ebenso wie für Jahresfeiern und Begräbnisse. In der westlichen Nilregion wurde die Gruppe gespielt, wenn die neuen Häuptlinge gefeiert wurden sowie zu allen anderen grossen Versammlungen.

Agwara
quergeblasenes Horn - Blasinstrument
Diese Instrumente stammen von den Stämmen der Lugbara und Kebu aus der westlichen Nilregion und werden in Gruppen von sieben oder mehr gespielt. Diese quergeblasenen Hörner besitzen manchmal ein einzelnes Fingerloch, das für Vorschlagornamente eingesetzt wird.
Die Instrumente der Iteso und Karimojong sind aus Kuhhörnern gefertigt und besitzen nur ein Mundstück zum Kommunzieren und Abgeben von Signalen.
Instrumente, die durch eine schwingende Luftsäule Töne erzeugen, werden als Aerophone bezeichnet. Hörner sind eine Art der Blechblas- oder Lippentoninstrumente.

- Akadinda - Embaire - Entaara - Amadinda
Xylophon - Schlaginstrument
Die Holzstäbchen der verschiedenen Xylophone der Region können auf verschiedene Art und Weise zur Resonanz gebracht werden, um die Töne zu verstärken. Die Resonanzkörper können die Form kleiner hohler Objekte unterhalb jedes Stäbchens annehmen, die Form eines gemeinsamen Resonanzkörpers für alle Stäbchen, oder sogar ein Loch, das in den Boden gegraben ist. In dieser letzteren Form liegen die Stäbchen parallel zueinander über dem Loch, das etwa 70 cm tief und beinahe zwei Meter breit ist. Der Musiker schlägt die linken Stäbchen (den Bass) mit einem Schlegel aus ziemlich weichem Holz und die rechten Stäbchen mit einem schweren und krummen Schlegel aus extrem harten Holz an. Die Tasten einer kleineren Version dieses Xylophons sind über einem flacheren Loch angeordnet. Dieses kleinere Xylophon liefert melodische und rhythmische Ostinatos als Stichnote für das grössere Hauptxylophon, das unterschiedliche Themen spielt, um die Gottheiten dazu zu überreden, anlässlich der Zeremonien für den Vodun (Voodoo) zu tanzen. Ein Paar Rasseln und eine Eisenglocke runden immer das Spiel dieses Doppelxylophons ab, und das Spiel wird auch oftmals von Liedern begleitet.
Das Xylophon ist in der Bantu-Region sehr beliebt. Die Stäbchen sind entweder durch lange Stöckchen (bei den Baganda) oder durch kurze Stöckchen voneinander getrennt und auf Bananenstielen befestigt. Die Bakonzo und die Basoga verwenden sowohl kurze als auch lange Stöckchen. Die Stäbchen werden an ihrer Position gehalten, indem ein Faden durch kleine Löcher im Holz gefädelt wird.
Das Amadinda besitzt zwei "Schultern"; die auf dem Boden eingeschnitzt sind, so dass die Stäbchen, wenn sie nicht anders befestigt sind, sich nach ihrer Positionierung auf den Bananenstielen nicht bewegen. Heutzutage ist das gesamte Instrument aus Holz gefertigt.
Die Amadinda und die Akadinda unterscheiden sich in Grösse und Anzahl der Holzstäbchen, obwohl beide in einem pentatonischen Mass mit gleichen Intervallen gestimmt sind. Die Amadinda besitzt grössere Stäbchen. Früher besass diese bis zu 22 Stäbchen. Es benötigte fünf Männer, um die Version mit 17 Stäbchen sowie sechs Männer um die Version mit 22 Stäbchen zu spielen. Das grössere Instrument ist heutzutage äusserst selten anzutreffen und wird für den Kabaka (den König der Baganda) gespielt. Heute kann die Akadinda zwischen 10 und 20 Stäbchen besitzen, und die Amadinda besitzt 12 Stäbchen und wird von drei Männern gespielt. Ein Spieler spielt nur die zwei höchsten Töne, während die anderen zwei Musiker verschiedene Melodien auf den übrigen zehn Stäbchen spielen. Diese Melodien sind oftmals Abwandlungen von Vokalstücken, die für das Xylophon adaptiert wurden. Das Wechselspiel zwischen den Melodien der Spieler (wobei jeder in Oktaven spielt) erzeugt eine dritte Melodie mit einem längeren metrischen Zyklus. Durch diese miteinander verflochtene Technik können zwei Spieler eine einzelne Melodie in einem sehr schnellen Tempo spielen, ohne dass die Spieler dabei sich extrem körperlich betätigen müssen. Die Kompositionsstruktur der von beiden Instrumenten gespielten Stücke ist im Wesentlichen gleich, nur dass die 20-Stäbchen-Amadinda von vier Musikern und die Version mit 10 Stäbchen von einem Solokünstler (so etwa anlässlich des Hochzeitstanzes (der Mbaga) gespielt wird.
Instrumente, die durch die Schwingung ihrer gesamten Körper Klänge erzeugen, werden als Idiophone bezeicnet.

Akogo - Likende - Akadongo - Sansa - Mbira - Akalimba
Daumenklavier - Schlaginstrument
Für dieses Instrument gibt es viele verschiedene Namen: Kalimba, Sansa und Mbira sind die am weitesten verbreiteten Bezeichnungen. Dieses Musikinstrument besteht aus einer Reihe flexibler Metall- oder Rohrzungen unterschiedlicher Länge, die an einer Holzplatte oder an einem trapezförmigen Resonanzkasten befestigt sind. Heute wird der Resonanzkasten aus Kiaatholz gebaut, und die Zungen bestehen aus hochqualitativem Federstahl. Der Musiker hält das Instrument in beiden Händen und zupft mit seinen Daumen die leicht nach oben gedrehten freien Enden der Zungen. Die Anzahl und Anordnung der Zungen oder Lamellen variiert regional. In Uganda wird das Instrument gewöhnlich als Soloinstrument gespielt, um etwa den einsamen Treck eines Reisenden oder die lange Wachzeit eines Nachtwächters zu erleichtern. Das Instrument begleitet ein Repertoire an "Liedern zum Nachdenken" oder von Männern und Frauen gesungenen Trauerliedern.
In Buganda ist das Instrument als "akadongo kabaluru" oder "kleines Instrument des Alur-Stamms" aus der nordwestlichen Nilregion bekannt. Die Mbuti-Pygmäen in Amba verwenden Rattanrohrtasten sowie einen U-förmigen Steg. Der Stamm der Basoga spielt verschiedene Sansastile.
Sansas werden gewöhnlich in eine diatonische G-Dur-Tonleiter gestimmt, obwohl sie jederzeit in eine beliebige Tonleiter zurückgestimmt werden können.
Instrumente, die durch die Schwingung ihrer gesamten Körper Klänge erzeugen, werden als Idiophone bezeicnet.

- Engalabi
Lange Trommel - Schlaginstrument
Diese traditionelle Trommel besitzt einen Kopf, der aus Reptilienhaut gefertigt und an einem hölzernen Resonanzkörper befestigt ist. Die Engalbi aus der Region Buganda spielt bei Zeremonien und im Theater eine sehr wichtige Rolle. Sie wird als " Okwabya olumbe" bezeichnet, d.h. Nachfolgers eines Verstorbenen; es gibt in der Lugandasprache der Baganda das Sprichwort "Tugenda mungalabi", was so viel heisst wie, wir gehen zur Engalabi, d.h. "lange trommeln".
Beim Spielen der Trommel dürfen nur die blossen Hände verwendet werden.
Instrumente, die Klänge durch die Schwingung einer gedehnten Membran oder Haut erzeugen, werden als Membranophone bezeichnet. Trommeln gibt es in vielen verschiedenen Formen.

- Engoma
Ugandische Trommel - Schlaginstrument
Embuutu; grosse Trommel, Empuuny; Basstrommel
Während grössere Versionen dieser Trommel traditionellerweise aus alten Hartholzbäumen geschnitzt werden, sind diese Trommeln heute aus Kieferholzplatten gefertigt, die gemeinsam wie Fässer zusammengesetzt sind. Kleinere Trommeln werden auf einer Drehbank laminiert und gedreht und können einen Strick besitzen, um das Instrument zu tragen. Alle diese Trommeln besitzen Köpfe, die aus Haut gefertigt sind, die von Stiften gehalten wird, die in die Seiten der Trommeln gehämmert wurden.
Diese Trommel gefiel mir auch gut!
- Entenga - Namandu
- drum chimes - drum set - percussion instrument
- Ensaasi - Akacence - Enseege
Schüttelrohre- Schlaginstrument
Schüttelrohre bestehen aus Kürbis- oder Muschelpaaren, die manchmal Stockgriffe besitzen: Sie werden zur Begleitung traditioneller Instrumente verwendet. In den zentralen und nördlichen Regionen in Uganda (z.B. Alpaa Region) gibt es Schüttelrohre, die einen kontinuierlichen Ton erzeugen, wenn die Perlen sich im Kürbis oder in der Muschel von einer Seite zur anderen bewegen. Im Allgemeinen erzeugen diese Schüttelrohre dadurch ein Geräusch, dass viele kleine Objekte wie etwa Kieselsteine im Inneren des Körpers gemeinsam geschüttelt werden.
Instrumente, die Klänge durch Schwingung ihrer gesamten Körper erzeugt werden, bezeichnet man als Idiophone.
Das hört sich wirklich gut an. Hatte ich auch in den Händen.
- Ebinyege - Binyege (Entongoro) Rasseln - Schlaginstrument
Diese haben ihren Ursprung in Bunyoro und in der Batooro (Toro) Region in Westuganda entlang der Ausläufer des Ruwenzori Gebirges. Die Samen werden in diese trockenen Früchte eingefüllt, um rhythmische Muster zu erzeugen, wenn diese geschüttelt werden.
Die Ebinyege werden an den Beinen der Männer befestigt, um zum Klingen gebracht zu werden, und der Runyege-Tanz (Werbungstanz der Batooro) ist nach den Ebinyege benannt und besitzt somit einen hohen Stellenwert.
Die hatte ich auch an den Beinen und war versucht sie zu kaufen. Habs dann doch gelassen.
- Endege
Knöchelglocken - Schlaginstrument
Tänzer haben oftmals Metallglöckchen an ihren Knöcheln befestigt, um ihre Bewegungen in Tönen auszudrücken.